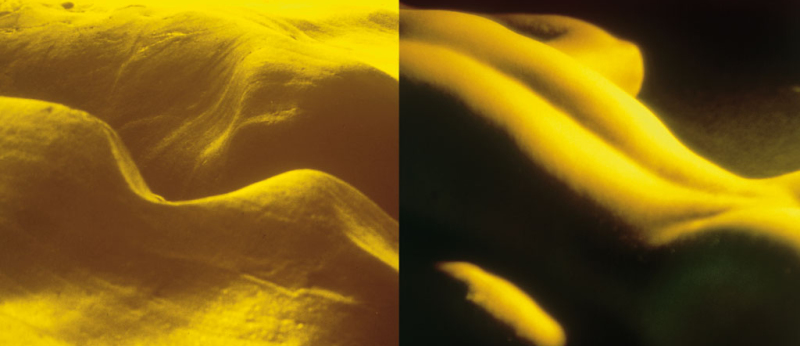
22. Juni
Ärztliches Symposium /
Fachveranstaltung
10 Pkt. LÄK/BW
Psychosomatik -
Wo bleibt die Somatik?
Psychoneuroimmunologie | Psychokardiologie Stressmedizin | Neuropsychologie
Die Fortbildung ist mit 10 Punkten der Landesärztekammer
Baden-Württemberg bewertet und von den Schweizerischen Fachgesellschaften (SGPP / SAPPM) als Kernfortbildung anerkannt. Die deutschen Ärztekammerpunkte werden Ihnen den Bedingungen der
Schweizerischen Fachgesellschaften
entsprechend anerkannt.
| Donnerstag, 22.06.2017 | |
|
9.00 Uhr |
Begrüßung / Moderation
|
| 9.15 Uhr |
Couch, Labor oder Hochseilgarten?
|
| 10.00 Uhr |
Von der Psychoneuroimmunologie (PNI) zur Zukunft der Medizin
|
| 11.00 Uhr | Pause |
| 11.45 Uhr |
Gesundheit und Krankheit –
|
| 13.00 Uhr | Mittagspause - Imbiss und Atmosphäre |
| 14.00 Uhr |
Wie viel Seele braucht das Herz?
|
| 15.00 Uhr |
Herzratenvariabilität (HRV) und Autonomes Nervensystem (ANS)
|
| 15.45 Uhr | Pause |
| 16.30 Uhr |
Der Mensch: Und er bewegt sich doch!
|
| 17.00 Uhr |
Vom Behandeln zum Handeln -
|
| 17.30 Uhr |
Vitamin-D-Mangel und das ZNS –
|
| 18.15 Uhr |
Läuse, Flöhe oder beides? Die Problematik der Depressions-Demenz-Differentialdiagnostik in der Psychosomatik
|
|
19.00 Uhr |
Diskussion, Fragen an die Referenten, geselliger Nachklang –
|
Inhalte
| Vorträge | |
|
9.00 Uhr
Begrüßung / Einführung
Dr. med. Till Bastian
|
Wo Leben herrscht, sind Leib und Seele untrennbar miteinander verbunden. Deshalb ist jene Abstraktion, die wir „Krankheit“ nennen (konkret gibt es nur kranke Menschen!) immer „psychosomatisch“
oder „somatopsychisch“ –
|
|
9.15 Uhr
Couch, Labor oder Hochseilgarten?
|
Was hilft den Menschen, gesund ein gelingendes Leben zu führen? Das fragen sich seit jeher Mediziner, Psychologen, Psychotherapeuten und Philosophen.
|
|
10.00 Uhr
Von der Psychoneuro-immunologie (PNI) zur Zukunft der Medizin
|
Warum lassen sich von der Psychoneuroimmunologie (PNI) die größten zukünftigen Innovationen in der medizinischen Forschungsempirie und klinischen Praxis erwarten? Weil sie den Übergang vom
biomedizinischen zum biopsychosozialen Medizinparadigma markiert! Darauf verweisen komplexe Erkenntnisse und Überlegungen zur PNI, die üblicherweise nicht in der Mainstream-PNI-Literatur referiert
werden. Die Geschichte der PNI zeigt, dass bereits ihre ersten empirischen Ergebnisse insofern als radikal anzusehen waren, als dass sie die verschiedenen Anteile des Stresssystems nicht mehr
unabhängig voneinander, sondern in funktionsdynamischer Beziehung zueinander sahen (z. B. immunoneuroendokrines Netzwerk). Mittlerweile gibt es in der PNI auch erste Hinweise dazu, wie die
Schnittstellen und Übergänge zwischen den biologischen, psychologischen und sozialen Schichten des biopsychosozialen Modells geartet sein könnten (z. B. behaviourales Immunsystem). Neuere klinische
Forschungsansätze (z. B. integrative Einzelfallstudien) ermöglichen zudem auch unter „life as is it lived“-Bedingungen der menschlichen Alltagsrealität ökologisch valide Einsichten in die
biopsychosoziale Modellkonzeption.
|
|
11.45 Uhr
Gesundheit und Krankheit –
|
Wie andere Säugetiere, verfügt der Mensch über lebenswichtige biologische Alarmsysteme, die sein Überleben gesichert haben. Diese zumeist unbewusst agierenden Mechanismen haben sich im Verlauf der Evolution bewährt und stehen uns heute nach wir vor zur Verfügung. Gleichzeitig entwickelte sich im Laufe der Menschheitsgeschichte, gefördert durch die Sesshaftigkeit und der damit verbundenen zwischenmenschlichen Kooperation und Arbeitsteilung, eine besondere geistige Leistungsfähigkeit, die im Tierreich eine herausragende Rolle einnimmt. Oft wird diese Fähigkeit mit dem Begriff der Kognition oder Intelligenz umschrieben und bildet ein wichtiges Unterscheidungskriterium gegenüber anderen Lebewesen.
Hierbei wird der kommunikative Aspekt als entwicklungs-förderndes Element besonders hervorgehoben. Als „kommunikatives Wesen“ ist der Mensch an Beziehungen orientiert und auf Beziehungen angewiesen. Tatsächlich könnte man das menschliche Gehirn auch als „Beziehungsorgan“ bezeichnen. So erschöpfen sich unsere kommunikativen Fähigkeiten nicht nur auf unsere Sprache, sondern erstrecken sich auf zahlreiche andere Kommunikationsmöglichkeiten. Diese evolutive Besonderheit befähigt uns Menschen einerseits zu besonderen Leistungen, sie ist aber zugleich Quelle für so genannte „moderne Zivilisationskrankheiten“. In diesem Vortrag sollen diese Aspekte in einem verhaltenspsychologisch-neurowissenschaftlichen Kontext gestellt werden.
|
|
14.00 Uhr
Wie viel Seele braucht das Herz?
|
Eine Vielzahl psychosozialer Risikokonstellationen werden als Faktoren diskutiert, die neben den klassischen Risikofaktoren (Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Rauchen, Übergewicht und Diabetes mellitus) mitverantwortlich für die Entstehung einer koronaren Herzerkrankung sein können und als chronischer Stress zusammengefasst werden. Zweifellos hat aber der Einfluss einer depressiven Gestimmtheit und Hoffnungslosigkeit die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Evidenzlage hierzu ist erstaunlich.
|
|
15.00 Uhr
Herzratenvariabilität (HRV) und Autonomes Nervensystem (ANS)
|
Als neuronaler Teil unseres allgemeinen Anpassungs-, Regulations- und Kommunikationssystems ist das autonome Nervensystem eine der wichtigen funktionellen Schnittstellen zwischen Körper und Psyche. Mittels der Herzratenvariabilitäts-messung können wir die Aktivität des autonomen Nervensystems und seiner auch wichtigen Komponenten, des Sympathikus (Leistungssystem) und Parasympathikus (Erholungssystem), beurteilen.
|
|
16.30 Uhr
Der Mensch:
|
Ausgehend davon, dass der Mensch auch ein sich bewegendes Wesen ist bzw. sein will, wird das Thema zunächst aus philosophischer Sicht beleuchtet und daraus ein theoretischer Bezugsrahmen abgeleitet. Dies liefert eine Basis für das exemplarische Aufzeigen sowie eine praktische Umsetzung der Theorie „Bewegung als grundlegende Verhaltensweise des Menschen.“
|
|
17.00 Uhr
Vom Behandeln zum Handeln - Sport und Bewegung in der Klinik Wollmarshöhe
|
Sport- und Bewegungstherapie bei psychosomatisch erkrankten Patienten. Konzept und Umsetzung in der Klinik Wollmarshöhe. Vom Behandeln zum Handeln. |
|
17.30 Uhr
Vitamin-D-Mangel und das
|
Calcitriol, die wirksame Form des Vitamin D, ist eine Steroid-substanz, die Genaktivitäten beeinflusst / steuert. Darüber hinaus hat Vitamin D eine neuroprotektive Funktion, induziert die Bildung
neurotropher Faktoren und fördert damit Neuro-neogenese und Plastizität. In weiten Teilen der Bevölkerung westlicher Länder ist ein Vitamin-D-Mangel nachweisbar.
Vitamin-D-Mangel wird mit zahlreichen Störungen / Erkrankungen des ZNS in Verbindung gebracht, die von kognitiven Einbußen im Alterungsprozess, demenziellen Erkrankungen, M. Parkinson bis hin zu ADHS, Depression und Schizophrenie reichen. Ob der Mangel einen Risikoindikator oder einen Risikofaktor darstellt, ist bislang ungeklärt. Lediglich bei der MS verdichten sich die Hinweise, wonach ein Vitamin-D-Mangel eine bedeutende Rolle in der Ätiologie und dem Voranschreiten der Erkrankung zukommt.
|
|
18.15 Uhr
Läuse, Flöhe oder beides?
|
Bei psychosomatischen Erkrankungen (Depression, Angststörungen, somatoforme Schmerzstörungen) äußern die Betroffenen nicht selten Beschwerden über begleitende kognitive Defizite. In einem modernen psychosomatischen Behandlungskonzept ist es wichtig, die Patienten an diesem Punkt ernstzunehmen und gegebenenfalls entsprechende neuropsychologische Untersuchungen ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit durchzuführen.
In verschiedenen Fallbeispielen wird gezeigt, dass sich hinter bzw. neben einer ausgeprägten psychischen Symptomatik auch einmal ein in Gang gekommener demenzieller Prozess verbergen kann. Eine möglicherweise vorliegende Demenz von einer Pseudodemenz im Rahmen einer schweren Depression zu unterscheiden, ist nicht immer einfach und erfordert eine umfassende neuropsychologische, psychiatrische und psychodiagnostische Erhebung.
|

